Mehr geht (n)immerEin Wohnklo für 360 Euro
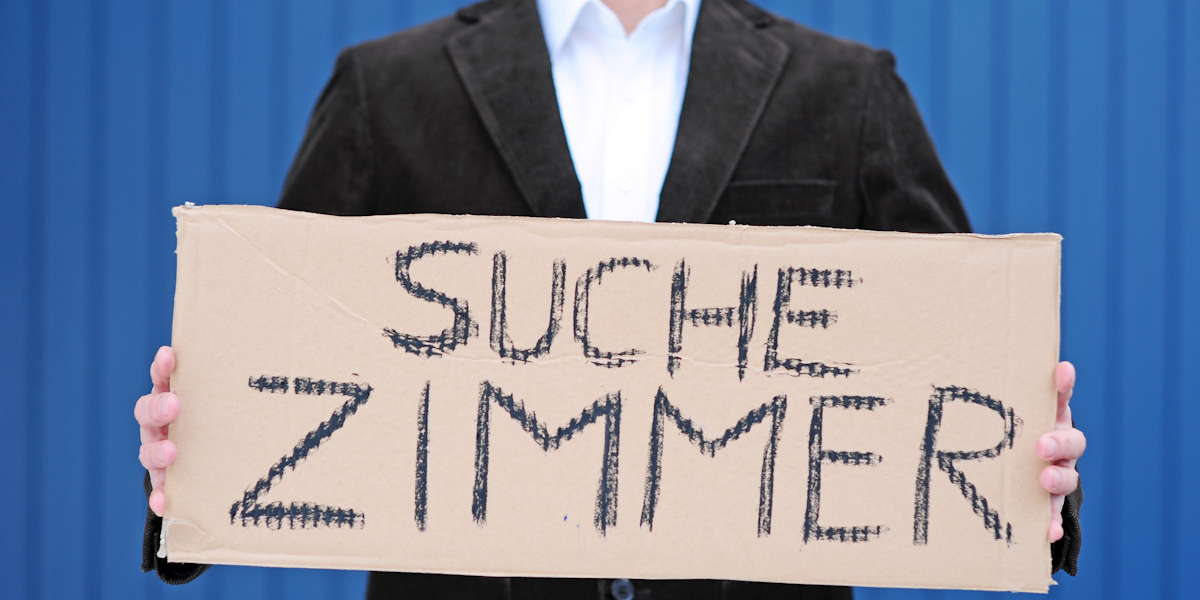
Ist das Wörtchen Wohnungsnot steigerungsfähig? Vielleicht: Wohnungsobernot. Was der Begriff beschreibt, hält sich jedenfalls nicht an Obergrenzen. Seit gefühlt zwei Dekaden schreibt Studis Online über das Scheitern Zehntausender Studierende, rechtzeitig zum Start des Wintersemesters eine passende oder überhaupt eine Bleibe aufzutun. Und mit jedem Mal spitzt sich die Situation zu.
Insofern markiert der aktuelle Zustandsbericht wieder nur einen vorläufigen Höhepunkt der Misere – von wegen: Im nächsten Jahr wird`s schlimmer, jede Wette! Nur leider nimmt die Öffentlichkeit von dem Problem bis heute kaum Notiz. Das liegt daran, dass die Betroffenen weder eine Lobby haben noch die nötige Präsenz zeigen. Am vergangenen Sonnabend zogen ein paar Dutzend von ihnen mit einem „Protestzug“ durch die Münchner Innenstadt. War was?
Düstere Zukunft
Dabei gäbe es Leidensgenossen genug, mit denen man sich zusammentun und Radau machen könnte: Azubis, Schüler, junge Familien, Alleinerziehende, sozial Benachteiligte, Migranten. Sie alle haben bei der Suche nach erschwinglichem Wohnraum schlechte Karten. Aber die wenigen Offerten, die es noch gibt, jagen sie sich gegenseitig ab. Bei dem Gedränge ist für Solidarität buchstäblich kein Platz.
Das ist schade und doch zu verständlich. Nur wo soll das hinführen? Der Ende September veröffentlichte „Studentenwohnreport 2023“ des Finanzdienstleisters MLP skizziert eine düstere Zukunft. Nach den Befunden wird das Angebot an Wohnraum noch auf ganz lange Sicht nicht mit der Nachfrage mithalten.
Dabei kommen verschiedene Faktoren zusammen. Die hohen Zinsen würgen die Bautätigkeit ab. Eigentlich hatte die Ampelregierung das Ziel ausgegeben, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen. Im Vorjahr waren es nicht einmal 300.000 – Tendenz fallend. Dabei beziffert der Deutsche Mieterbund (DMB) den Mangel allein schon für das laufende Jahr mit rund 700.000, wobei vor allem Sozialwohnungen und günstiger Wohnraum fehlten.
Miete frisst Budget
Weil sich inzwischen selbst finanziell Bessergestellte aufgrund drastisch gestiegener Bau- und Finanzierungskosten ein Eigenheim nicht mehr leisten können, drängen auch sie auf den Mietwohnungsmarkt, was einmal mehr die Preise hochtreibt. Dazu hat nach dem Ende Corona-Krise die Zuwanderung wieder angezogen, speziell die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine müssen untergebracht werden.
Die rund 20 Millionen Haushalte, die in Deutschland zur Miete wohnen, bringen dafür heute im Schnitt 28 Prozent ihrer Einnahmen auf. Und je geringer die Einkünfte sind, desto höher fallen im Verhältnis die Aufwendungen fürs Wohnen aus. Während Menschen mit festem Job und geregeltem Einkommen die Belastungen noch stemmen können (längst nicht alle), ist bei Studierenden irgendwann Schluss.
Gemäß Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks (DSW) mussten vor zwei Jahren 37 Prozent der Hochschüler in Deutschland mit monatlich 800 Euro und weniger über die Runden kommen, zehn Prozent schlugen sich gar mit höchstens 400 Euro durch. Unter diesen Bedingungen ist der Punkt nicht mehr weit, an dem ein Studium schlicht nicht mehr finanzierbar ist, zumal bei Wohnkosten, die kein Halten mehr kennen.
Scheitern aus Platzmangel
„Wohin das alles führt“, fragt sich auch MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg im Vorwort besagten Reports, der in Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) entstand. Antwort: „Hoffentlich nicht dazu, dass sich junge Leute künftig aufgrund der schwierigen Wohnsituation gegen ihren präferierten Studiengang oder gar grundsätzlich gegen die Aufnahme eines Studiums entscheiden.“
Wobei das Ausschlusskriterium nicht einmal nur der Preis fürs Wohnen sein müsste. Schließlich verfügt immerhin ein Viertel der Studierenden über 1.300 Euro und mehr im Monat. Das reicht sogar für ein obszön überteuertes WG-Zimmer in München, Hamburg oder Berlin. Demnächst könnten aber selbst Studierwillige mit gefestigtem finanziellen Background ihre Zukunftspläne an den Nagel hängen. Weil es einfach keine Bude mehr für sie gibt in München, Hamburg oder Berlin.
Oder in Greifswald. Auch dort ist die Not inzwischen so groß, dass die Rektorin der örtlichen Universität, Katharina Riedel, einem Studienanfänger im eigenen Haus ein kostenloses Zimmer offeriert. Das ist gut gemeint, aber doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Perspektivisch könnte höhere Bildung bald – neben einer Frage des Geldes, wie dies gerade für Deutschland ohnehin schon gilt – zu einer Frage des Wohnraums werden. Der Weg dahin ist zweifellos vorgezeichnet.
Überall teurer
Ist nicht München am teuersten?
In anderen Erhebungen ist meist München die teuerste Stadt, was WG-Zimmer oder insgesamt studentischer Wohnraum anbelangt. Im Grundsatz kommen aber alle Erhebungen auf immer weiter steigende Preise und teure Städte sind überall teuer. Nur die „Platzierung“ mag ein wenig variieren. Aber da niemand alle Mietpreise ermitteln kann, sondern immer mit Stichproben arbeiten muss, sind Unterschiede ganz normal. An der Grundaussage ändert das nichts.
Der Notstand in Zahlen: Laut MLP-Report, der Daten bis August 2023 auswertete, haben sich die Kosten auf dem studentischen Wohnungsmarkt an allen 38 untersuchten Hochschulstandorten deutlich erhöht, im Mittel um 6,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Die Vorgängerstudie hatte noch einen Aufschlag von 5,9 Prozent verglichen mit 2021 ergeben.
Den größten Satz machte Heidelberg mit einer Steigerung um acht Prozent, womit dort für eine Musterwohnung mit 30 Quadratmetern eine Warmmiete von durchschnittlich 524 Euro fällig wird. Ein WG-Zimmer in der Stadt am Neckar schlägt mit 409 Euro zu Buche, was einer Steigerung von „nur“ zwei Prozent entspricht. „Spitzenreiter“ in puncto teuer ist Frankfurt am Main. Für eine Wohnung werden dort 696 Euro (plus 5,9 Prozent) aufgerufen, für ein WG-Zimmer 494 Euro (plus 9,1 Prozent).
Dicht darauf folgt München (695 Euro / 480 Euro), danach kommen Stuttgart (616 Euro / 456 Euro), Bonn (598 Euro / 457 Euro) und Darmstadt (571 Euro / 418 Euro). Den sechsten Rang hat Freiburg inne, hier kostet eine Wohnung 570 Euro und ein WG-Zimmer mit 438 Euro satte 14,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Getoppt wird das noch von Bochum (plus 14,9 Prozent), Rostock (plus 16,9 Prozent) sowie eben Greifswald. Dort legt man mit 295 Euro für ein WG-Zimmer mal eben 20,4 Prozent mehr als 2022 hin.
Heizkosten: plus 43 Prozent
Vergleichsweise günstig ist es in Magdeburg, das den „letzten“ Platz belegt. Hier verlangen Vermieter 282 Euro für eine Wohnung und 238 Euro für ein WG-Zimmer. Magdeburg und Chemnitz sind die einzigen der gelisteten Städte, in denen sich mit dem nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhältlichen Wohnzuschlag von 360 Euro eine Musterwohnung bezahlen lässt. In München bekommt man dafür gerade einmal ein Wohnklo mit 14 Quadratmetern Fläche.
Mit enthalten sind in den Aufstellungen sämtliche Nebenkosten, wobei laut Studie allein die Abschläge fürs Heizen seit Anfang 2022 um 43 Prozent hochgeschnellt sind. Angesichts dessen erscheinen die von der Bundesregierung bewilligten Heizkostenzuschüsse sowie die nach einer langen Hängepartie ausgeschüttete Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro ziemlich kümmerlich.
Derweil wird dieser Tage wie jedes Jahr aus allen Teilen der Republik über Studierende berichtet, die verzweifelt nach einer Unterkunft suchen, in Notquartieren unterkommen oder im Hotel Mama Zuflucht suchen, weil für sie einfach kein Platz da ist. Nach DSW-Angaben stehen allein bei elf Studierendenwerken an den hochpreisigen Standorten München, Köln, Frankfurt, Berlin oder Darmstadt 35.000 Studierende auf den Wartelisten für einen Wohnheimplatz.
Ampel als Preistreiber?
Der Wohnheimausbau wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten sträflich vernachlässigt, das Deutsche Studierendenwerk (DSW) fordert seit einer gefühlten Ewigkeit eine Bauoffensive in der Größenordnung von mindestens 25.000 neuen Plätzen. Immerhin ein „Lichtblick“ ist für Anbuhl das durch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) auf den Weg gebrachte Bund-Länder-Programm „Junges Wohnen“, mit dem bezahlbarer Wohnraum für Studierende, Azubis und Polizeianwärter geschaffen und modernisiert werden soll. Allerdings wird der Bundeszuschuss von geplant 500 Millionen Euro jährlich nicht genügen, das Versäumte nachzuholen, zumal dann nicht, wenn immer mehr Studierende auf dem freien Wohnungsmarkt auf der Strecke bleiben.
Und mit dem gerade beschlossenen Heizungsgesetz der Bundesregierung steht neues Ungemacht ins Haus. Weil die Politik die Wärmewende nur unzureichend fördere, drohten ausgerechnet studentischen Mietern in den staatlichen Wohnheimen weitere Preiserhöhungen, warnte zuletzt das DSW. Dabei hätten gerade Studierende aus sozial benachteiligten Haushalten und ausländische Studierende – die Hauptklientel der Wohnheime – auf dem freien Wohnungsmarkt „kaum Chancen“. Sie noch zusätzlich zu belasten, „das kann niemand ernsthaft wollen“, erklärte der DSW-Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl.
Wenn er sich da mal nicht täuscht. Denn wo es Verlierer gibt, gibt es immer auch Gewinner. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat zum 1. Oktober den variablen Zinssatz für ihren Studienkredit auf effektiv 9,01 Prozent hochgeschraubt. Das macht das Darlehen doppelt so teuer wie einen Immobilienkredit. Vielleicht will die Koalition, Politik damit ja einen Anreiz setzen. „Liebe Studierende: Wenn ihr keine Bleibe findet, baut Euch doch einfach selbst eine.“ (rw)